Auf dem Weg nach Traversasch
Das Leben, die Arbeit und auch die Kultur finden oft abseits der Hauptstrassen statt. Zum Beispiel hoch über dem Valsertal.
Das Leben, die Arbeit und auch die Kultur finden oft abseits der Hauptstrassen statt. Zum Beispiel hoch über dem Valsertal.
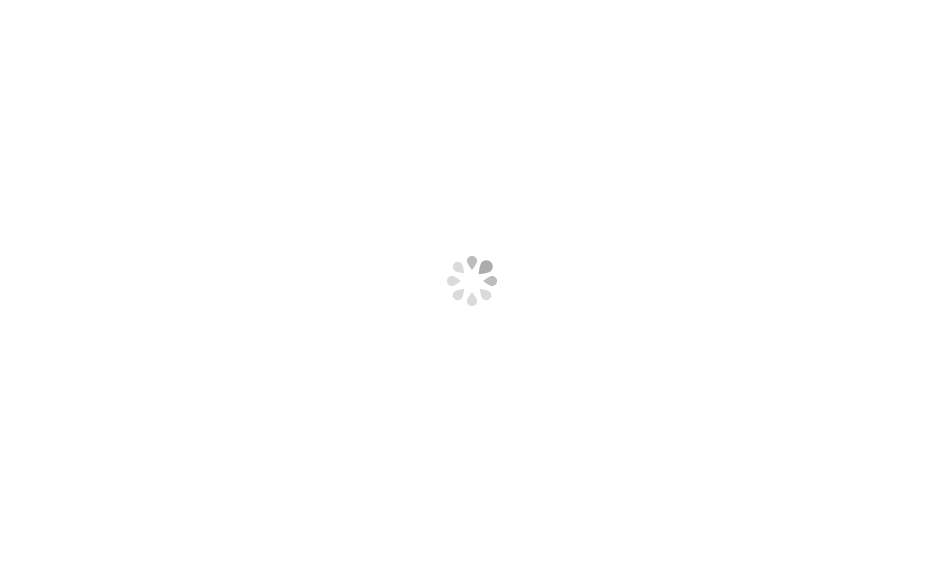
Text: Franz Bamert | Fotos: Vannick Andrea
Wer nicht ganz gut aufpasst, der hat in St. Martin den Abzweiger nach Traversasch schon verpasst. Ganz versteckt hinter ein paar Sträuchern, biegt der Fahrweg ab und windet sich hinauf zu einem Flecken Graubünden, der ursprünglicher nicht sein könnte. Schon in Orten wie Marjaga oder Munt könnte man sofort einen Heidi-Film drehen. Doch weiter gehts hinauf, vorbei an 200 Meter tiefen Tobeln, an steilen Felswänden, und gerade, wenn der Jeep mit Vierradantrieb in einem Steilstück bockt, gerade wenn man meint, dass es nun nicht mehr weitergehen kann, dass sich der Weg in Fels, Eis und Schnee verliert, öffnet sich das Tal wieder. Dann liegt er da, der Weiler Traversasch auf 1700 Meter. Ein paar Ställe, ein, zwei Häuser und eine Aussicht auf die Berge der Surselva, die unbezahlbar ist.
Und ausgerechnet für die Sicherung dieser Strasse hat sich die Coop Patenschaft mit mehreren 10 000 Franken engagiert. Warum zum Teufel gerade hier, hoch über dem Valsertal? War der Beitrag an die Steinschlag- und Lawinensicherung wirklich nötig? Bistgaun Capaul hat als Vertrauensmann der Coop Patenschaft für Berggebiete das Verbauungsprojekt ausgewählt. Zusammen mit dem Gemeindepräsidenten von St. Martin, Martin Albin, begleitet er die Coopzeitung auf dieser Reportage. «Traversasch ist nicht nur ein Stück Bündner Geschichte, hier oben gibt es eine Alp, hier oben sind die besten Heuwiesen der Talbauern», sagt Albin. Solange die Bauern hier heuen, verhindern sie auch die Erosion: Jahr für Jahr ziehen sie die Wassergräben neu, damit es zu keinen Stauungen und Rutschungen kommt, welche auch die Kantonsstrasse nach Vals, weit unten im Tal, bedrohen würden. Und hier oben liegt die vielleicht schönste, aber sicher unbekannteste Kirche Graubündens. Ein paar abgewetzte Holzbänke, die noch für kleinere Menschen gemacht waren, Butzenscheiben, zwei Glöcklein. Aber ein Altar geschmückt wie für ein Hochamt.
Irgendwann im 13. oder 14. Jahrhundert kamen die Walser auf ihrer Flucht vor Hunger, Pest, der Obrigkeit oder allem zusammen auch hier hinauf nach Traversasch. Und hier lebt derzeit der vielleicht letzte Traversascher, Placi Albin, zusammen mit seiner Mutter Annamaria und ist Bauer wie seine Vorfahren. Im Sommer kommen ab und zu Wanderer oder die Talbauern zu Besuch. Aber jetzt im Winter – geht man da nicht fast ein vor Einsamkeit? «Ich kenn mich da ja nicht so aus – aber unten in Zürich sind die Menschen glaub ich viel einsamer als hier oben. Dass man einen, der allein gestorben ist, erst nach Wochen gefunden hat, das gabs bei uns auf jeden Fall noch nicht», sagt der Bauer. Er redet vom Vieh, vom Heuen, vom Schneeschaufeln, vom Wegmachen, vom Wassergräben ziehen. Vom einfachen Leben halt. Und manchmal geht er auch ins Tal «und dann bin ich wirklich gottenfroh, dass die schlimmste Stelle auf dem Weg gesichert ist.» Und froh sind sie hier in der Gegend alle, dass die Coop Patenschaft eingesprungen ist. «Wir haben in St. Martin gut 30 Einwohner – wir hätten uns finanziell völlig überlupft», sagt der Gemeindepräsident.
Dann wird es Zeit zu gehen, denn wenns gegen Abend gefriert, wird der Weg ins Tal im Winter zur Eisbahn. Doch zum Abschied gibt uns Mutter Albin noch eine Geschichte mit auf den Weg, die Sinn oder Unsinn relativiert: «Als die im Safiental – also auf der anderen Seite des Berges – zum neuen Glauben übertraten, gingen die Unseren hinüber und holten die Schwarze Madonna – die wäre sonst zerstört worden.» Das war während der Reformationszeit, und seither steht die Madonna in der Kirche von Traversasch und wird von Generation zu Generation weitergegeben. (An alle Kirchenräuber – sie ist schwer gesichert). Und während wir die Albins und all die Schründe, Abgründe und Tobel zurücklassen, setzt sich im Kopf ein Gedanke fest: Die Lawinen- und Steinschlagnetze sind gut und recht und machen das Berglerleben ein bisschen sicherer. Doch die alte Frau Albin, die vertraut wohl auch für den Rest ihres Lebens lieber auf die Schwarze Madonna, wenn sie mal wieder ins Tal hinunter muss.